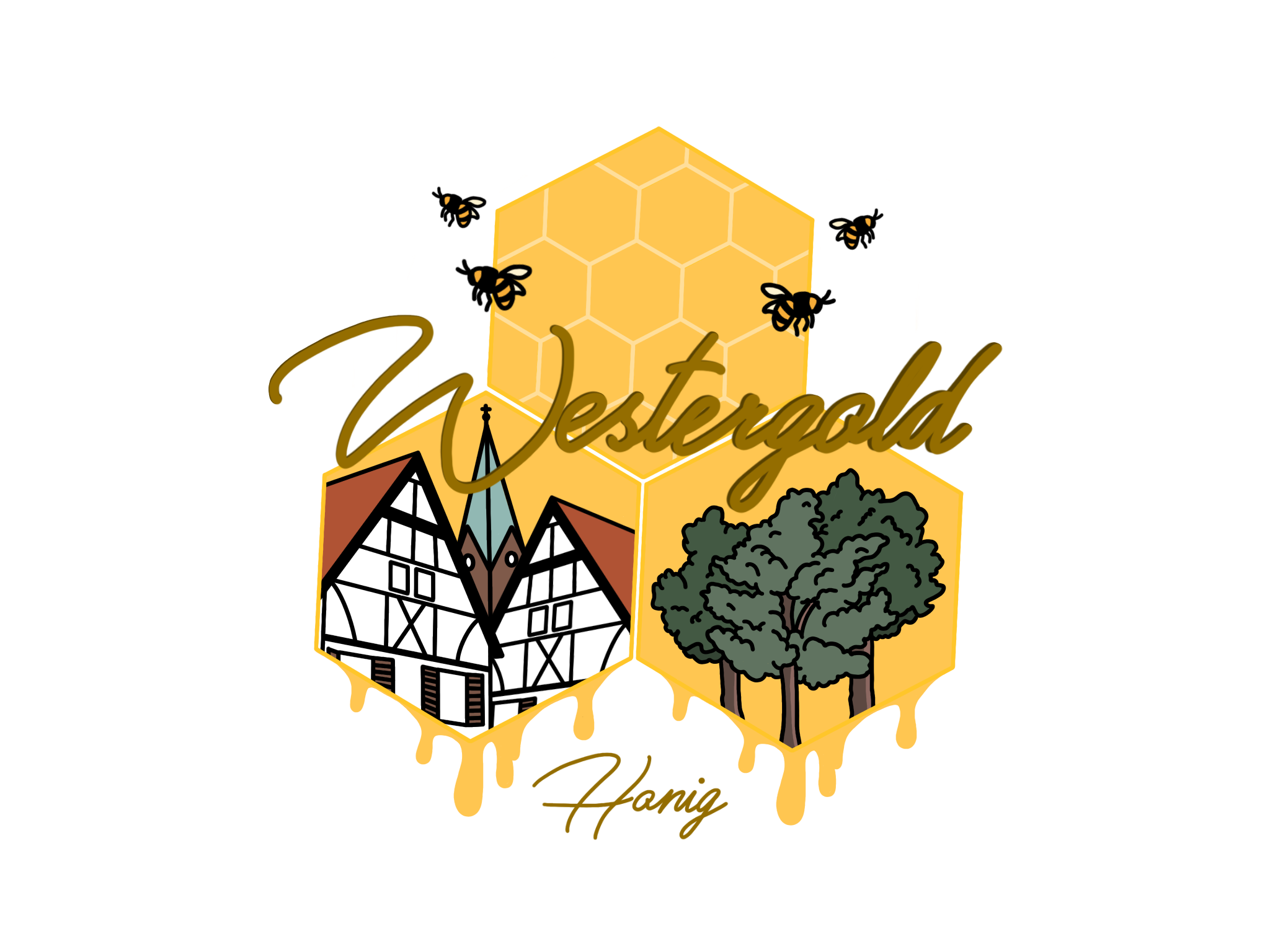Warum sind Imker wichtig?
Hier möchten wir die Bedeutung von Imkern heute betonen und einige Missverständnisse aufklären. Oft wird angenommen, dass Imker ihre Bienen nur aus wirtschaftlichen Gründen betreuen. Zudem stehen wir manchmal in der Kritik, Bienen nicht artgerecht zu halten oder ihnen den Honig wegzunehmen, um ihn durch minderwertiges Zuckerwasser zu ersetzen. Diese Vorwürfe entstehen meist aus Unwissenheit oder Missverständnissen.
In Wirklichkeit sind Imker ein oft unterschätzter, aber entscheidender Teil des Ökosystems. Wir überwachen die Gesundheit unserer Bienenvölker, bekämpfen Krankheiten und fördern das Bewusstsein in der Gesellschaft um die Bedeutung der Honig- als auch Wildbienen mit sehr viel Leidenschaft dahinter. Ohne unsere Betreuung geht die Lebenswahrscheinlichkeit eines Bienenvolkes in der Natur, Richtung 0. Die Gründe dafür sind eine komplexe Kombination aus: Umweltveränderungen vor allem durch den Menschen, Einschleppung von invasiven Arten wie Varroa destructor, Vespa velutina und anderen Arten, Spritzmitteleinsatz sowohl in urbanen Städten, als auch in der Landwirtschaft und noch viele weitere.
Imker stehen in engem Kontakt mit ihren Bienen und der Umgebung, in der sie leben, und entwickeln so ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Bienen. Der Vorwurf, wir würden den Bienen den Honig „klauen“, ist unbegründet. Wer sich intensiver mit der Bienenhaltung beschäftigt, erkennt, dass wir Imker mit den Bienen eine Art „Pakt“ eingehen. Wir betreuen jedes Bienenvolk das ganze Jahr über mit großer Sorgfalt, um sicherzustellen, dass es den Winter übersteht. Als Teil dieser Arbeit entnehmen wir einen Teil des überschüssigen Honigs, aber niemals den gesamten Honigvorrat. Der verbleibende Honig reicht aus, um das Volk ausreichend zu versorgen, selbst wenn das Wetter schlecht ist und kein Honig geerntet werden kann.
Letztlich ist die Arbeit der Imker essenziell, um die Honigbienen zu schützen und ihr Überleben zu sichern, was wiederum unser gesamtes Ökosystem stabilisiert.

Die traurige Wahrheit des 21. Jahrhunderts
Der „aktuelle Erzfeind“ des Imkers und des Bienenvolkes 🐝⚠️
In der heutigen Zeit hätte ein Bienenvolk, das beispielsweise als Schwarm in eine Baumhöhle einzieht, leider kaum Überlebenschancen. Ohne die Betreuung durch einen Imker würde es vielleicht ein Jahr überleben und danach absterben. Der Hauptgrund dafür ist die Einschleppung des asiatischen Parasiten Varroa destructor, der seit 1977 in Deutschland verbreitet ist. Diese Milbe wird von Sammlerbienen unbewusst aus der Umgebung ins Volk eingeschleppt. Sie krabbelt auf die Biene und gelangt so in den Bienenstock.
Einmal im Bienenvolk angekommen, nutzt die Milbe die Gelegenheit, kurz vor dem Verschließen einer Brutzelle hineinzukriechen. In der Zelle beginnt sie sich zu vermehren und ernährt sich von der Bienenlarve. Ob sie sich dabei vom Fettkörper oder von der Hämolymphe (Bienenblut) ernährt, ist noch nicht vollständig geklärt. Gleichzeitig können die Milben die Larve mit gefährlichen Viren wie dem Flügeldeformationsvirus (FDV) oder dem Chronischen Bienenparalysevirus (CBPV) infizieren.
Die infizierte Biene schlüpft geschwächt und missgebildet aus der Zelle und stirbt oft innerhalb weniger Tage. Mit ihrem Schlupf setzen die Milben auch ihre Nachkommen frei, was zu einer raschen Vermehrung der Milben führt. Dadurch erkranken immer mehr Bienen im Volk, was schließlich zum Kollaps des gesamten Bienenvolks führen kann.
Neben der akuten Bekämpfung der Varroa-Milbe durch den Einsatz von organischen Säuren oder biotechnischen Maßnahmen arbeiten Imker und Wissenschaftler auch an langfristigen Lösungen. Züchtungsprogramme zielen darauf ab, widerstandsfähige Bienenvölker zu entwickeln, die besser mit der Milbe umgehen können. Diese Forschung ist besonders wichtig, da der Klimawandel das Problem der Varroa-Milbe weiter verschärfen könnte, indem wärmere Temperaturen das Wachstum und die Verbreitung der Milben begünstigen.
Ohne die regelmäßige Kontrolle und Behandlung durch Imker wäre es daher für ein Bienenvolk sehr schwierig, in der heutigen Umwelt zu überleben. Imker spielen eine zentrale Rolle dabei, die Gesundheit der Bienenvölker zu erhalten und sie vor Parasiten wie der Varroa-Milbe zu schützen.
Imker tragen jedoch nicht nur zur Gesundheit der Honigbienen bei, sondern fördern auch die Bestäubung zahlreicher Pflanzen, die für die Landwirtschaft und die Artenvielfalt von entscheidender Bedeutung sind. Durch ihre Arbeit helfen Imker, den Rückgang der Bienenpopulationen zu verhindern, was auch dem Erhalt vieler Wildpflanzen und Nutzpflanzen zugutekommt. Während Honigbienen stark von der Varroa-Milbe betroffen sind, sind auch Wildbienen wichtige Bestäuber, die nicht von der Varroa befallen werden und dennoch zur Bestäubung beitragen. Imker und Naturschützer arbeiten daher auch zusammen, um diese wertvollen Insekten zu schützen.
Viele Imker engagieren sich zudem in der Aufklärung der Öffentlichkeit über die Bedeutung der Bienen und die Herausforderungen, denen sie ausgesetzt sind. Sie bieten Workshops, Schulprojekte oder Führungen an, um das Bewusstsein für den Schutz der Bienen zu erhöhen und die Bevölkerung für den Naturschutz zu sensibilisieren.
Moderne Imker legen außerdem zunehmend Wert auf nachhaltige Praktiken. Dies umfasst den Einsatz natürlicher Materialien in der Bienenhaltung, die Förderung der Biodiversität durch bienenfreundliche Pflanzen und den Verzicht auf chemische Pestizide. Durch solche Praktiken tragen Imker aktiv zum Umweltschutz bei.
Letztlich ist die Arbeit der Imker essenziell, um die Honigbienen zu schützen und ihr Überleben zu sichern, was wiederum unser gesamtes Ökosystem stabilisiert.
Die Folgen eines unkontrollierten Varroa-Drucks im Bienenvolk
(Trifft bei einem unbetreuten Bienenschwarm fast zu 100% zu)
Irgendwann ist das gesamte Bienenvolk so geschwächt, dass es zusammenbricht. Es gibt nicht mehr genug gesunde Bienen, die die wichtigen Aufgaben im Volk erledigen können. Ein Beispiel ist die Fluglochwache. Diese Aufgabe wird von den Wächterbienen übernommen. Sie schützen das Volk vor anderen Honigbienen, Hornissen und Wespen. Fehlen diese Bienen, ist das Volk der Umwelt schutzlos ausgeliefert. Andere Bienen (sogenannte Räuberbienen) können nun das ungeschützte Volk ausrauben und die Honigvorräte stehlen. Dies führt dazu, dass den Bienen der Wintervorrat in der Beute fehlt. Es kommt zudem zu Bienenkämpfen, bei denen Verletzungen und weitere Infektionen mit Krankheiten entstehen können. Dieses Phänomen wird als Räuberei bezeichnet und kann ernsthafte Krankheiten wie Amerikanische Faulbrut (AFB) hervorrufen.
Das geschwächte Volk ist nun nicht mehr in der Lage, gesunde Winterbienen zu erzeugen, die für den Winter überlebenswichtig sind. Etwa 15.000 bis 18.000 Winterbienen haben die Aufgabe, das Volk über mehrere Monate zu wärmen und somit den Fortbestand zu sichern – auch bei Temperaturen von bis zu 0°C. Die schwachen, kranken und kurzlebigen Winterbienen überleben jedoch keine zwei Wochen. Wenn der Imker die Beute öffnet, wird er ein totales Volk vorfinden.
Wenn die Honigbiene in der heutigen Zeit schwärmt
Dieses Szenario betrifft vor allem Bienenschwärme, die in der heutigen Zeit in Baumhöhlen oder anderen unbeaufsichtigten Behausungen einziehen, wo sie nicht betreut werden können. Solche Schwärme entwickeln sich oft zu Seuchen-Hotspots, die eine Gefahr für andere Bienenvölker darstellen. Diese geschwächten Schwärme sind nicht mehr in der Lage, sich effektiv zu verteidigen, werden von stärkeren Bienenvölkern ausgeraubt und sterben schließlich ab. Besonders kritisch wird dies im Zusammenhang mit der Amerikanischen Faulbrut (AFB). Diese Krankheit betrifft nicht nur das ausgeraubte, bereits geschwächte Volk, sondern auch die räubernden Bienen und das gesamte Umfeld.
Besteht der Verdacht auf einen Faulbrutfall in einem Bienenstand, muss ein sogenannter Sperr- oder Untersuchungsbezirk eingerichtet werden. Innerhalb dieses Gebiets sind sämtliche Bienenvölker auf den Erreger der Amerikanischen Faulbrut (Paenibacillus larvae) zu untersuchen. Je nach Befund müssen betroffene Völker entweder saniert oder im schlimmsten Fall gezielt abgetötet (geschwefelt) werden, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Es ist daher unsere Pflicht als Imker, solche Seuchen-Hotspots durch eine verantwortungsvolle Betreuung unserer Bienen zu vermeiden.
Wie können wir solchen Szenarien vorbeugen?
Der Schutz der Bienen vor der Varroamilbe gehört zu den wichtigsten Aufgaben eines Imkers. Aktuell wird die Varroabekämpfung meist nach der Honigernte durch Blockbehandlungen (nach jedem Brutzyklus) mit organischen Säuren wie Ameisensäure, Oxalsäure, Milchsäure oder Thymolpräparaten durchgeführt. Dabei ist zu beachten, dass diese Behandlungen auch dazu führen können, dass bereits erkrankte Bienen und Brut absterben.
Es gibt jedoch auch medikamentenfreie Methoden, um die Vermehrung der Varroamilbe einzudämmen. Dazu gehören Verfahren wie die Totale Brutentnahme, das Bannwabenverfahren oder das Königinnenkäfigen. Diese Methoden mögen für den Imker zwar aufwendig und unangenehm sein, aber sie sind das kleinere Übel im Vergleich zum Verlust eines unbehandelten, geschwächten Volkes. Nur durch rechtzeitige und effektive Maßnahmen können wir sicherstellen, dass die Bienenvölker gesund in den Winter gehen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die kontrollierte Teilung der Bienenvölker, um die Entstehung von wilden Schwärmen zu verhindern. Dies kann durch regelmäßige Schwarmkontrollen geschehen. Sollte der Schwarmtrieb dennoch einsetzen, können Verfahren wie die Kunstschwarmbildung oder die Bildung von Ablegern gezielt eingesetzt werden, um die Völker zu vermehren, ohne dass sie unkontrolliert ausschwärmen.
Als Imker haben wir außerdem die Verantwortung, unsere Gesellschaft über diese sensiblen Themen aufzuklären und Missverständnisse zu beseitigen. Nur durch ein besseres Verständnis für die Herausforderungen der Imkerei und die Bedeutung gesunder Bienenvölker können wir gemeinsam einen Beitrag zum Schutz der Bienen leisten.